Doris Lessing: Das Tagebuch der Jane Somers
Oder: eine Geschichte von Anreicherung, Neuordnung und Integration
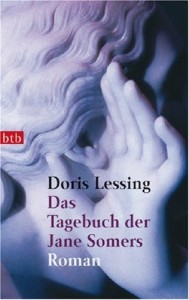
Doris Lessing: Das Tagebuch der Jane Somers
Nach Beschäftigung mit einigen ihrer Texte lässt sich feststellen, dass sie im Allgemeinen durchaus keine gefällige, unterhaltende Literatur produzierte, sondern Kraft ihrer Romane und Geschichten soziale Missstände aufzeigen und kritisieren wollte – sie arbeitete also, systemisch betrachtet, an der Bildung von Unterschieden, die einen Unterschied machen sollten. Rückblickend auf ihr Werk beschreibt Doris Lessing eines ihrer Hauptanliegen wie folgt
Wachsam und unbequem bleibt sie bis ins hohe Alter: Als sie 88-jährig, im Jahr 2007, endlich den Nobelpreis für Literatur erhält, bezeichnet sie diesen einerseits erfreut als „Royal Flush“, um ihn andererseits ein wenig später schon als zeitraubendes Desaster zu deklassieren (vgl. Berliner Literaturkritik 2009).
Auf gesellschaftskritischer Ebene finden sich im »Tagebuch der Jane Somers« der damaligen Zeit wie auch der Gegenwart wohl kaum unbekannte Missstände und Ungerechtigkeiten, wie beispielsweise die große Kluft zwischen Arm und Reich, krank und gesund, alt und jung. Und dennoch wage ich zu behaupten, dass dieser Roman selbst nahezu 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf der Ebene der persönlichen Entwicklung der beiden Protagonistinnen sehr wohl lesenswerte als auch nach-denkenswerte Elemente und Textpassagen enthält.
Die Leserin trifft anfangs auf die nahezu 50-jährige Karrierefrau Jane Somers, ehrgeizige, dynamische, stellvertretende Chefredakteurin eines angesehenen Modemagazins, die sich nach der Rückkehr von einer Geschäftsreise wie folgt beschreibt
Dieses positive, vitale und strahlende Selbstbild konnte sie sogar vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Mutter aufrechterhalten.
Der Reflexionsprozess der Protagonistin mittels Tagebuch setzt mit der Frage nach ihrer eigenen Identität ein: sie stellt sich die Frage, ›wie ich wirklich bin‹ (5), und es folgen eher assoziativ aneinander gereihte denn linear-logische Textabschnitte. Dennoch ist es gut möglich, als Leserin Zeugin, Beobachterin und eventuell Teilnehmerin dieser Prozesse von Anreicherung an Erfahrungen, von Neuordnung persönlicher Wertigkeiten und von Integration des Unaushaltbaren zu werden.
Als zuerst ihr Mann krank wurde und schließlich starb, war es Jane Somers nicht möglich, sich von seinem Leiden berühren zu lassen und Raum zu geben, mit ihm zu sprechen, ihn zu begleiten oder seine Endlichkeit wahrzunehmen – anders formuliert, ging sie aus dem Kontakt und ließ ihn und sich allein. Ähnlich verhielt sie sich bei ihrer Mutter, die einige Zeit bei ihr wohnte und dann schließlich verstarb. Krankheit und Tod gehörten ebenso wenig zu ihrem Leben, wie kranke und sterbende Menschen. Folglich gestand sie sich auch selbst keine Zeit zur Trauer zu, sondern suchte Ablenkung in Liebesaffären und vertiefte sich in ihre Arbeit, um nach und nach zu erkennen, dass ihre Identität hauptsächlich auf ihrem Beruf begründet ist und sie auch nichts anderes kann als zu arbeiten. Dieses wahrgenommene Defizit galt es daraufhin aktiv, gleichsam durch Üben, auszugleichen. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, sich gezielt in der Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen zu engagieren, begegnet sie zufällig der 91-jährigen, gebrechlichen Maudie Fowlers. Die Greisin gehört der Unterschicht an, führt ein armes und mehr als bescheidenes Leben in einer verkommenen, verschmutzten Wohnung: und dennoch lässt sich Jane Somers auf diese Begegnung ein, woraufhin sich auch ihre Perspektive auf die Gesellschaft verändert und weiter wird
Immer wieder ambivalent in ihrem Zugeständnis, der missmutigen, zornigen und sogar übel riechenden alten Frau von ihrer Zeit, Geduld und Freundlichkeit zu geben, schwankt sie zwischen Bleiben und Flucht, vor allem, als sie merkt, dass ihre eigenen Bedürfnisse und Werte – Mosaiksteine ihrer Identität – wie beispielsweise ausgedehnte Bäder, ausgiebige Beschäftigung mit Kleidung und Klassenbewusstsein, in den Hintergrund treten und teilweise zu verblassen beginnen. Auf der Strasse nach dem Verhältnis zu Maudie gefragt, antwortet sie spontan
Das konnte man von zirka zehn verschiedenen Gesichtspunkten aus nur als eine unerhörte Behauptung bezeichnen, und am unerhörtesten war, dass ich das Wort nicht zwischen Anführungszeichen gesetzt hatte. Da erst fiel mir ein, dass man keine Freunde aus der Arbeiterschicht zu haben hat. Mein Verhältnis zu Mrs Fowler konnte alles mögliche sein, einschließlich das einer guten Nachbarin, aber nicht das einer Freundin. (52)
Doch im Laufe der Geschichte wird es für Jane immer selbstverständlicher, zu Maudie als Freundin zu stehen, für sie da zu sein, für sie zu sorgen, sie auszuhalten und sie an ihrem eigenen Leben teilhaben zu lassen. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine lebendige Dynamik, innerhalb oder Kraft derer es beiden unter anderem möglich wird, gegenseitige Nähe zuzulassen, aber auch zu streiten und sich außerdem auf ein Geben und Nehmen einzulassen. Sie begegnen einander mittels Geschichten aus beider Leben: Maudie wird noch einmal lebendig und strahlend, als sie von früher erzählt, während Jane in der Gegenwart ihre Zeugin ist, sie anhört und würdigt. Umgekehrt erfährt Maudie aus Janes Leben, gleichsam aus einer Welt, die ihr selbst verweigert blieb.
Um ihre Freundin noch besser verstehen und deren Erlebtes nach-empfinden zu können, schreibt Jane einen Tagesablauf der alten Frau in ihr Tagebuch, der sich aus Beobachtungen und Erzählungen zusammensetzt. Der Prozess des Niederschreibens kann neben dem Versuch des Erfassens und Ordnens durchaus auch als eine Übung in Empathie und Achtsamkeit gelesen und verstanden werden. Manche Äußerungen und Verhaltensweisen bleiben dabei für sie fremd, wohingegen sie sowohl die Dimension der Einsamkeit und Entbehrungen als auch die Wichtigkeit und den Reichtum ihrer Freundschaft zu erahnen beginnt
Weil sie ihr Leben reicher und vielschichtiger zu gestalten vermag, gelingt es Jane auch, ihre Prioritäten, ihre Wertigkeiten neu zu ordnen, ihren Blick auf die Welt und auf sich selbst und andere zu weiten. So widmet sie sich beispielsweise ihrer Schriftstellerinnenlaufbahn und veröffentlicht erfolgreich Romane. Außerdem rückt sie die Arbeit im Verlag aus ihrem alleinigen Fokus, reduziert Stunden, gibt schließlich gern Verantwortung an jüngere Kolleginnen ab und akzeptiert gleichermaßen so die Endlichkeit ihrer eigenen Autonomie, Gesundheit und verbleibenden Zeit
Als wesentlicher Teil oder Auswirkung eben jenes oben beschriebenen Prozesses kann meiner Meinung nach die Auseinandersetzung mit Veränderung, Krankheit und Tod gesehen werden. Jane entwickelt sich von einer »Kindfrau« (6), die von der Existenz der Endlichkeit stets verschont werden musste, zu einer erwachsenen, reflexions- und liebesfähigen Frau, die bei der Erkundung ihrer nicht gelebten Trauer um Ehemann und Mutter unter anderem folgendes erkennt
Ich wollte nicht, so lautet die Antwort. Ich wollte es nicht wissen. (83f)
Als ihre Freundin und Arbeitskollegin Joyce bekannt gibt, ihrer Familie zuliebe nach Amerika zu gehen, und auch diese Veränderung für Jane unaufhaltsam ist, vermag sie ihrer Härte und Vitalität nicht mehr gerecht zu werden und beginnt, ihr »gefrorenes Herz« (106) auftauen zu lassen. Beschämt und schuldbewusst ob des vorher nicht erlebten Schmerzes erfährt sie vorerst einmal gleichsam den Preis des Auftauens, dessen Intensität sie durch eine ihr bekannte und bislang wirksame Strategie zu mildern versucht
Aber ich habe keine Zeit dafür. Ich schufte wie besessen. Und rase dabei vor Kummer. Ich bin nicht so sicher, dass das unbedingt ein Schritt vorwärts zu größerer Reife ist. Ein gefrorenes Herz hat seine Vorteile. (106)
Dennoch fokussiert die Protagonistin nicht ausschließlich die ungenützten Chancen und Möglichkeiten im Kontakt zu ihrem Mann und ihrer Mutter, sondern sie gestaltet nun vielmehr aktiv ihre eigene Erzählung in ihrer aktuellen Gegenwart neu: Als Maudie eines Tages ins Krankenhaus geliefert wird und dort nur mehr einige Wochen zu leben hat, bleibt Jane im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Grenzen bei ihrer Freundin und besucht sie. Es scheint, als könnten beide Frauen durch den Kontakt zur jeweils anderen so etwas wie Nahrung ihrer Bedürfnisse nach Nähe und Bezogenheit erfahren – Nähe, der sie sich beide lange verschlossen haben.
Folgende Erkenntnis lässt annehmen, dass Jane das Unaushaltbare, in Form von Krankheit und Tod, Armut und Unglück in reale Bestandteile des menschlichen Lebens transformieren und schließlich integrieren konnte, was ihr unter anderem letztlich auch ein gesteigertes Bewusstsein im Neudefinieren und Wahrnehmen der schönen und angenehmen Dinge ermöglichte
Bei Maudies Beerdigung wenig später, nimmt Jane einen weiteren Unterschied in ihrem Erleben und Verhalten wahr, der letztendlich ihren inneren Prozess treffend charakterisieren könnte: von emotionaler Abwesenheit, von Ausschluss hin zu mehr Bezogenheit und Zugewandtheit
Angesichts der zahlreichen geglückten Unterschiedsbildungen, persönlichen Veränderungen und Neugestaltungen der Protagonistin liegt es einerseits nahe, den Leserinnen eine vergnügliche Lektüre dieses Buches von Doris Lessing zu wünschen; um jedoch die Mühen der inneren Prozesse, unter anderem den Umgang mit Verlust und Trauer, ein Stück weit würdigen zu können, scheint mir andererseits jedoch, dass der abschließende Wunsch eines friedlichen und bereichernden Leseerlebnisses der Vielschichtigkeit und Intensität des Romans »Das Tagebuch der Jane Somers« gerechter wird.
Bibliographie
Primärliteratur
Lessing Doris (1997) Das Tagebuch der Jane Somers. Ernst Klett, Stuttgart
Sekundärliteratur
Adams L W (2008) Doris Lessing Q and A. In: TIME, 11. Juli 2008
Cramer S, Domsch S, Vogt J (s.d.) Doris Lessing in: Domsch S, Heitmann A, Hijiya-Kirschenreit I, Kissel W, Klinkert Th, Winckler B (Hg.) 86. Nlg. Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur – KLfG.
Mayer S (2007) Beruf: Reisende. In: Zeit Online, 19. Oktober 2007
Reddemann L (2008) Würde – Annäherung an einen vergessenen Wert in der Psychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart
Reuther A (2009) Lust am Provokanten: Die Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing wird 90. In: Die Berliner Literaturkritik, 16. Oktober 2009
Das Buch »Das Tagebuch der Jane Somers« im Online-Shop kaufen.
Patricia Bohrn
Dr.in Patricia Bohrn, Pädagogin, Psychotherapeutin (Systemische Familientherapie)
www.bohrnpatricia.net

